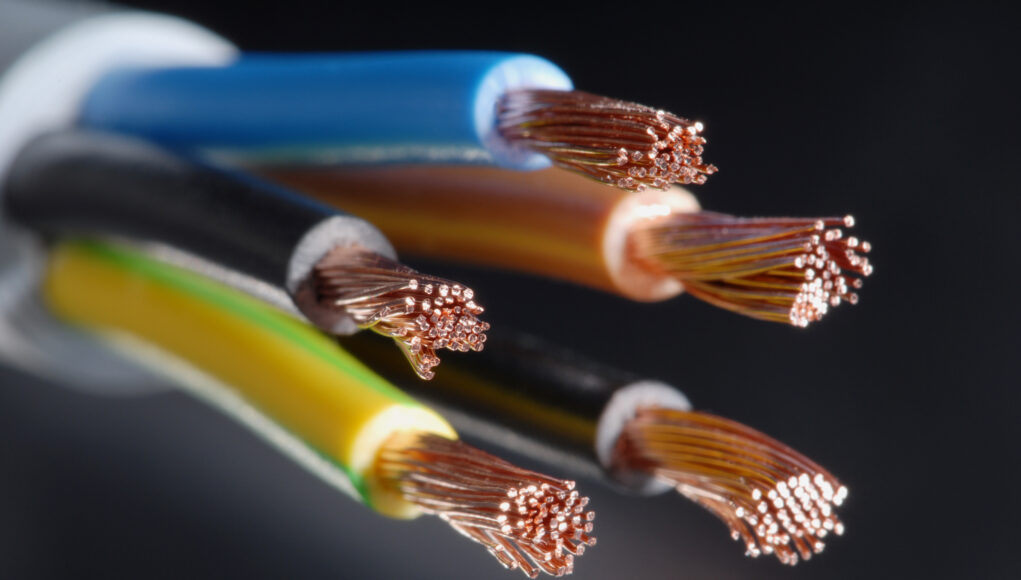Kupfer ist das zentrale Metall der globalen Energiewende. Auch wenn Rohstoffe wie Lithium oder Nickel zeitweise stärker im medialen Fokus standen, ist Kupfer aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften – Haltbarkeit, Verformbarkeit und herausragende Leitfähigkeit – unersetzlich für den Ausbau erneuerbarer Energien, der Elektromobilität und moderner Stromnetze.
Kupfer findet Anwendung in nahezu allen Zukunftstechnologien: Photovoltaikanlagen, Windkraftwerken (onshore und offshore), Batterien, Wärmepumpen und in der Ladeinfrastruktur. Damit zählt es zu den strategisch wichtigsten und gleichzeitig kritischsten Metallen des 21. Jahrhunderts.
Vier strukturelle Nachfragefaktoren
- Elektrofahrzeuge: Ein Elektrofahrzeug benötigt rund das 2,5‑Fache der Kupfermenge konventioneller Fahrzeuge. 2024 stieg der weltweite Absatz von Elektroautos laut IEA um rund 31 %, über 17 Millionen Fahrzeuge wurden verkauft – Tendenz weiter steigend.
- Stromnetze: Bis 2050 wird die Stromnetz-Kupfernachfrage laut International Copper Association voraussichtlich um das Vier‑ bis Fünffache zunehmen. Besonders der Ausbau von Hochspannungs-Gleichstromverbindungen (HGÜ) und Unterseekabeln treibt den Bedarf.
- Solar- und Windenergie: Offshore-Windparks benötigen bis zu das Fünffache der Kupfermenge fossiler Kraftwerke pro Megawatt Leistung. Mit dem weltweiten Ausbau erneuerbarer Kapazitäten auf über 5 Terawatt bis 2030 wird der Kupferbedarf weiter dynamisch wachsen.
- Bau und Elektronik: Bis 2035 dürften Bauwesen, Haushaltsgeräte und Elektronik gut 60 % des globalen Verbrauchs ausmachen. Das Wachstum der Mittelschicht in Asien, Afrika und Lateinamerika erhöht kontinuierlich den Bedarf an stromführenden Materialien.
Insgesamt dürfte die weltweite Kupfernachfrage von derzeit rund 27 Mio. Tonnen (2025) auf etwa 53 Mio. Tonnen bis 2050 steigen.
Engpass und Angebotsrisiken
Zwar existieren weltweit rund 900 Mio. Tonnen identifizierter, aber noch unerschlossener Kupfervorkommen, doch viele bestehende Minen nähern sich ihrem Fördermaximum. Der durchschnittliche Erzgehalt liegt nur noch bei etwa 0,45 %, also einem Bruchteil historischer Werte. Dadurch steigen die Förder- und Verarbeitungskosten weiter an, während neue Projekte immer kapitalintensiver und umweltpolitisch schwieriger werden.
Aktuell (Herbst 2025) klafft eine Versorgungslücke von rund 5–6 Mio. Tonnen jährlich, was bereits spürbar auf die Preise wirkt: Der Kupferpreis schwankte 2025 zwischen 9.000 und 10.500 USD pro Tonne – mit Tendenz nach oben.
Geopolitische und wirtschaftliche Hürden
Ein Großteil der weltweiten Förderung stammt weiterhin aus Chile und Peru, die zusammen über 35 % der globalen Produktion stellen. In Chile sorgten politische Unsicherheit, hohe Steuerbelastungen und Umweltauflagen zeitweise für Investitionszurückhaltung, auch wenn die Regierung zuletzt wieder stärker auf Kooperation mit internationalen Bergbaukonzernen setzt. Peru kämpft mit sozialen Spannungen rund um Minenprojekte, was zu temporären Produktionsrückgängen führte. Projekte in Afrika (u. a. Kongo, Sambia) gewinnen an Bedeutung, sind aber mit Infrastruktur- und Governance-Risiken behaftet.
Ausblick
Robert Friedland, Gründer von Ivanhoe Mines, warnte erneut 2025 vor einem strukturellen Kupferdefizit und sieht die Energiewende ohne massiven Ausbau der Bergbaukapazitäten gefährdet. Zwar sind seine Aussagen interessengeleitet, doch zahlreiche Analysten teilen die Einschätzung: Erst anhaltend hohe Preise und gezielte staatliche Unterstützung könnten die dringend notwendigen neuen Projekte wirtschaftlich machen.
Kurzum: Die „Kupferlücke“ der Energiewende wird sich weiter zuspitzen – und Kupfer bleibt eines der entscheidenden Materialien für den Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft.